07 Wettbewerbsrecht in der digitalen Welt
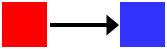
Aufgabe des Lauterkeitsrechts ist es, zu verhindern, dass ein starker Wettbewerb zu unfairen Praktiken der Marktteilnehmer führt. Das Lauterkeitsrecht will also den Wettbewerb abkühlen.
Das Lauterkeitsgesetz (UWG) ist Ausfluss des bereits in Art. 2 des Zivilgesetzesbuches (ZGB) statuierten Grundsatz von Treu und Glauben und wendet diesen speziell auf den Business-Bereich an. Das UWG handelt von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr.
Zur Aufsicht und Durchsetzung der lauterkeitsrechtlichen Regulierung gibt es keine (staatliche) Behörde, wie im Kartellrecht die WEKO. Allerdings hat die schweizerische Werbe- und PR-Branche eine Selbstregulierung (sog. «Soft law»; nicht staatlich durchsetzbare Regeln; s. dazu nachfolgend). Die Branche ist seit 1966 Trägerin der Stiftung der Schweizer Werbung für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation, der alle bedeutenden Organisationen der schweizerischen Kommunikationsbranche angehören. Das ausführende Organ der Stiftung ist die Schweizerische Lauterkeitskommission. Diese hat Grundsätze für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation aufgestellt. Diese Grundsätze können auf der Homepage der Lauterkeitskommission heruntergeladen werden: www.faire-werbung.ch oder www.lauterkeit.ch. Jede Person ist befugt, kommerzielle Kommunikation, die ihrer Meinung nach unlauter ist, bei der Lauterkeitskommission zu beanstanden. Die Kommission besteht aus drei Kammern, in welcher Konsumentinnen und Konsumenten, Medienschaffende und Werbende paritätisch vertreten sind. Die Schweizerische Lauterkeitskommission spricht keine staatlich durchsetzbaren Urteile aus. Sie erlässt Empfehlungen mit dem Ziel, dass diese von den Werbetreibenden zukünftig umgesetzt werden und somit rechtliche Risiken von Klagen oder Strafverfahren vor staatlichen Behörden vermieden werden können. Die Empfehlungen der Lauterkeitskommission sind jedoch bei den Unternehmen gefürchtet, kratzen sie doch an deren Reputation. Die Grundsätze der Lauterkeitskommission sowie deren Empfehlungen unterscheiden sich nicht wesentlich vom Lauterkeitsrecht. Sie konkretisieren diese, insbesondere für verschiedene spezifische Arten und Bereiche der Kommunikation, was insbesondere darum sehr wertvoll ist, als es in der Schweiz nur relativ wenige gerichtliche, insbesondere höchstrichterliche Entscheide zum Lauterkeitsrecht gibt.
Im internationalen Kontext kann auf die Standards der International Chamber of Commerce (ICC) für ein lautere kommerzielle Kommunikation, den Code for Advertising and Marketing Communication Practice verwiesen werden. Dazu kann bemerkt werden, dass generell im internationalen Business Standards wichtiger werden. Sie vereinfachen die internationale kommerzielle Zusammenarbeit, da sie universell und nicht territorial sind.
Struktur des Lauterkeitsgesetzes
Das Lauterkeitsgesetz ist so aufgebaut, dass zuerst in Art. 1 UWG der Zweck des Gesetzes statuiert wird, nämlich den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Dieser Artikel wird in der Praxis nie zitiert. Danach kommt der Kern des Gesetzes, der Grundsatzartikel Art. 2 UWG. Dieser kann generell auf alles unlautere Verhalten angewendet werden, sofern sich dafür in Art. 3 ff. UWG kein spezieller Tatbestand findet. In der Praxis sucht man also in der Regel vorab nach einem passenden speziellen Tatbestand in den Art. 3 ff. UWG. Wenn sich kein solcher findet, kann man immer noch den Grundsatzartikel Art. 2 UWG auf den Sachverhalt anwenden. Praktisches Problem der Anwendung des Grundsatzartikels Art. 2 UWG ist es, dass dessen Verletzung gemäss Art. 23 UWG nicht strafbar ist, also keinen Strafprozess zulässt (dazu nachfolgend; s. dazu auch 07 Innovationsschutz von digitalen Produkten → Durchsetzung von Immaterialgüterrechten). In Art. 9 ff. UWG werden dann die Rechtsmittel aufgeführt. Dabei ist generell der Zivilprozess möglich. Ist ein spezieller Tatbestand nach Art. 3 ff. UWG gegeben, kann gemäss Art. 23 ff. UWG auch ein Strafprozess eingeleitet werden.
Der Grundsatzartikel Art. 2 UWG setzt für die Anwendung des Lauterkeitsrechts zwei Bedingungen voraus, die kumulativ, also beide gleichzeitig gegeben sein müssen. Ersten muss eine Täuschung und/oder ein Handeln wider Treu und Glauben vorliegen. Zweitens muss das unlautere Verhalten den Markt beeinflussen. Ebenfalls muss der Verletzte selbst am Markt teilnehmen, damit er überhaupt betroffen ist und damit ein Rechtsmittel ergreifen kann.
In Art. 3 ff. UWG führt der Gesetzgeber Beispiele unlauteren Verhaltens auf, Spezialtatbestände, die (im Gegensatz zum Grundsatzartikel Art. 2 UWG) gemäss Art. 23 UWG neben dem Zivilprozess auch strafprozessual verfolgt werden können. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die für die digitale Welt besonders relevanten Spezialtatbestände beleuchtet.
