02 Rechtliche Organisation in digitalen Projekten
Wie erwähnt, beginnen Start-ups in der Regel als Einzelunternehmen («Unternehmen» im eigentlichen Sinne des Wortes: etwas unternehmen). In der Folge kommen dann weitere Personen zum Projekt hinzu. Damit stellt sich bereits die Frage, ob die weiteren Personen dem Einzelunternehmer unterstellt sind und damit wohl zu Arbeitnehmern werden (s. dazu Kapitel 03 Arbeitnehmer in der digitalen Welt), oder gleichgestellt sind und damit in irgendeiner Form zu Partnern werden.
Sind die weiteren Personen Arbeitnehmer des Start-up-Unternehmers, kann dieser das Projekt grundsätzlich auch als Einzelunternehmen weiterführen. Solange für den Einzelunternehmer in seinem Projekt keine grösseren Risiken bestehen und das Projekt in einem kleineren Umfang geführt wird, eignet sich diese Unternehmensform. Nehmen jedoch die Risiken zu, was insbesondere mit einem Wachstum einkehren wird, wird ein Einzelunternehmen für den Unternehmer selbst zum Risiko, denn ein Einzelunternehmer haftet gegenüber Dritten mit seinem ganzen privaten Vermögen, und zwar unbeschränkt (!).
Sind jedoch die Partner gleichgestellt, wird das Start-up zu einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR), solange das Unternehmen noch nicht nach aussen auftritt.
Sobald die Partner jedoch unter einer gemeinsamen Firma (Name des Unternehmens) auftreten, wandelt sich das Einzelunternehmen oder die einfache Gesellschaft in eine Kollektivgesellschaft nach Art. 552 OR. Dies ist m.E. eine sehr problematische Gesellschaftsform, da die Partner, sofern das Unternehmen keine eigenen Vermögenswerte mehr hat, ebenfalls mit ihrem privaten Vermögen unbeschränkt haften, zusätzlich auch noch solidarisch für die Unternehmenspartner (!). «Solidarisch» tönt für Leute, die nichts Böses denken, nett, ist in diesem Kontext aber brutal: ein Gläubiger kann von irgendeinem Gesellschafter die gesamte Schuld verlangen.
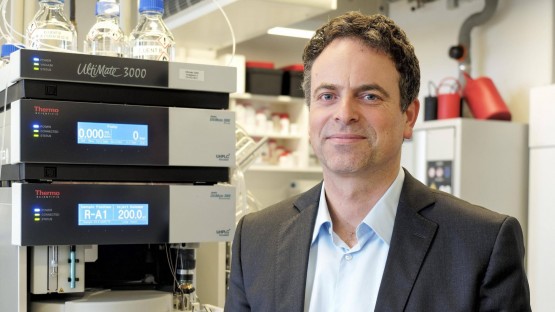
Insbesondere aus diesem Grund muss bei grösseren Risiken in diesem Moment die Gesellschaft in eine Form überführt werden, mit der die unmittelbare persönliche Haftung geblockt werden kann. Im englischen Sprachraum werden diese Gesellschaften darum als «Limited» (auf Gesellschaftsvermögen limitierte Haftung) bezeichnet. In der Praxis werden dafür in der Schweiz in der Regel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach Art. 772 ff. OR oder eine Aktiengesellschaft (AG) nach Art. 620 ff. OR gewählt. Dabei eignet sich die GmbH wiederum für eher kleinere Unternehmen und die AG für grössere. Die Form der AG sollte insbesondere dann gewählt werden, wenn Investoren an der Gesellschaft beteiligt werden sollen. Denn bei der GmbH ist die Übertragung der sogenannten Stammanteile eher mühsam. Zudem werden Gesellschafter einer GmbH zwingend im Handelsregister publiziert, während dem die AG eben, wie sie in der französischen Sprache heisst, eine Société Anonyme ist, also eine Gesellschaft, bei der die Teilhaber nicht im Handelsregister eingetragen werden (nur die Organe). Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass eine GmbH jederzeit und basierend auf dem Verfahren gemäss Fusionsgesetz (FusG) in einem Schritt (lat. uno actu) in eine AG umgewandelt werden kann (übrigens auch umgekehrt). Und wer als Start-up-Unternehmer schon grosse Pläne hegt: ein Börsengang ist nur mit einer AG möglich.
Eine interessante, wenn auch ungewöhnliche Idee ist die Gründung eines Vereins, um als Start-up äusserst unkompliziert und günstig zu einer juristischen Person zu kommen, die eben auch eine «Limited» ist, mit der man ebenfalls die persönliche Haftung für ein Unternehmen blocken kann. Der Verein ist, wie auch die nachfolgend beschriebene Stiftung, nicht im Obligationenrecht, sondern im Zivilgesetzbuch (ZGB, Art. 60 ff.) geregelt. Von Gesetzes wegen ist ein Verein eine Non-Profit-Organisation (Art. 60 Abs. 1 ZGB «nicht wirtschaftliche Aufgabe»). Dies gilt für den Verein als Ganzes. Der Verein darf jedoch für die Erfüllung dieses Zwecks ein Unternehmen führen («ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe»). Allfällige Gewinne aus diesem Unternehmen müssen jedoch wieder der Nutzung zugunsten des Vereinszwecks zugeführt werden. Führt ein Verein ein solches Unternehmen, muss er zudem zwingend in das Handelsregister eingetragen werden (Art. 61 Abs. 2 ZGB; generell ist ein freiwilliger Eintrag möglich [Art. 61 Abs. 2 ZGB]). Es bestehen keine gesetzlichen Mindestvorgaben zur Anzahl der Vereinsmitglieder (CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Christa Niggli, Art. 77 ZGB, RZ 7, Zürich 2023). Der «Einmann-» bzw. der «Einfrau-» Verein dürfte jedoch den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen. Dies ergibt m.E. nur schon aus der Natur der Institution (man kann sich – mindestens unter juristischen Gesichtspunkten – nicht mit sich selbst vereinen). Jedoch dürfte ein Verein mit zwei Mitgliedern rechtskonform sein (Urs Scherrer, Wie gründe und leite ich einen Verein?, Ziff. 30. Wie viele Personen sind zur Gründung eines Vereins notwendig?, Zürich 2017]. Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich publiziert eine umfassende Information (Merkblätter) und Musterurkunden zur Gründung eines Vereins und allfälligem Handelsregister-Eintrag unter folgendem Link: https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/handelsregister/verein/neu-eintragen.html.
Die vorne erläuterte Möglichkeit der Blockierung einer persönlichen Haftung mittels Gründung einer juristischen Person gilt nur für die Haftung für Tätigkeit als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer, jedoch nicht für die Haftung als Organ der juristischen Person, d.h. also z.B. als Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates und für Arbeiten in dieser Funktion (Art. 754 OR). Organ ist jemand, der wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hat (DIKE-Haftpflichtkommentar, Thierry Lauterbach, Vorbemerkungen zu Art. 754 – 760 OR, Rz 5). Verlangt ist ein pflichtwidriges Verhalten, also ein Verstoss gegen die den Organen durch Gesetz oder Statuten auferlegten Pflichten. Es wird jenes Mass an Sorgfalt erwartet, welches ein durchschnittliches, vernünftiges Organ in der gleichen Situation anwenden würde (Hans-Ueli Vogt, Gesellschaftsrecht, abgerufen 02.03.2024). Ein Beispiel aus meiner Anwaltspraxis. Wenn ich als Rechtsanwalt in meiner eigenen Anwaltskanzlei, die als Aktiengesellschaft organisiert ist, Mandate von Klienten bearbeite und mir dabei ein Fehler unterläuft, hafte ich in diesem Fall nicht als Organ der Gesellschaft gegenüber meinem Klienten, sondern die Gesellschaft haftet gegenüber meinem Klienten. Wenn es jedoch darum geht, dass ich Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer für die Gesellschaft eine Haftpflichtversicherung abschliesse, deren Deckung für Schäden aus der Tätigkeit von Anwaltskanzleien zu klein ist, hafte ich allenfalls als Organ der Gesellschaft persönlich für Schäden von Klienten, wenn diese dann nicht genügend gedeckt sind.
Insbesondere Projekte für Kryptowährungen, wie Bitcoin oder Ethereum, werden auch als Stiftung nach Art. 80 ff. des Zivilgesetzbuches (ZGB) organisiert. Bei der Gründung einer Stiftung wird ein Vermögen in die Institution eingebracht, das nur für die im Stiftungsstatut erwähnten Zwecke verwendet werden darf. Dabei kann der Stiftungszweck nach der Gründung nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen geändert werden. Zudem wird dieses Vermögen absolut verselbständigt. D.h. eine Stiftung hat keine Teilhaber. Das Vermögen wird mit der Gründung absolut verselbständigt. Einziges Organ einer Stiftung ist der Stiftungsrat. Dieser und die gesamte Stiftung untersteht zudem, je nach geografischer Ausrichtung des Stiftungszwecks, einer kantonalen oder der eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Damit kann festgestellt werden, dass die Form der Stiftung etwa so starr und damit natürlich auch so stabil ist, wie die Blockchains, die sie organisiert und darum nur für ganz bestimmte Projekte infrage kommt.
Weitere Informationen und Musterdokumente
Einen sehr gut guten Überblick über die Gesellschaftsformen hat Prof. Dr. Roland Müller von der Uni St. Gallen erstellt, der unter folgendem Link als PDF heruntergeladen werden kann: https://s75f21ec71f40e63c.jimcontent.com/download/version/1418716253/module/10112115012/name/Uebersicht_Gesellschaftsformen.pdf.
Für einen schnellen, summarischen Überblick eignet sich auch das Büchlein «Gesellschaftsrecht in a nutshell» von Lukas Handschin, Corinne Zellweger-Gutknecht und Simon Bader.
Umfassende Informationen (Merkblätter) und Musterdokumente publiziert das Handelsregister des Kantons Zürich zu allen Gesellschaftsformen unter folgendem Link: https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/handelsregister.html.
